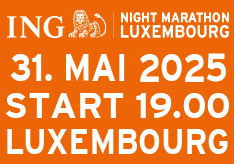Wir verwenden Cookies um Ihnen eine bestmögliche Nutzererfahrung auf unseren Websites zu bieten. Mit der Nutzung unserer Seiten und Services erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OKmarathon4you.de
Grand Raid Manikou, Martinique
19.20.21. Dezember 2008: Grand Raid Manikou, Martinique,
127 km, 6.000 Höhenmeter auf und ab bei tropischen Temperaturen mit
extrem hoher Luftfeuchtigkeit.
„Suchst Du das Abenteuer, komme dahin und Du wirst es finden!“
„Willst Du Dich selbst besser kennen lernen, mache den Raid und Du wirst über Dich selbst staunen!“
Geschichte und sonstiges Wissenswertes über Martinique
Die Antilleninsel Martinique ist französisches Überseedepartement und liegt ca. 400 km nördlich von Venezuela in der Karibik. Das Klima ist tropisch-feucht und unterschreitet zumindest auf Meeresniveau nie die Temperatur von 24 Grad Celsius.
Die Insel wurde schon 1635 von der Grande Nation in Besitz genommen, und 1946 wurde sie integraler Bestandteil Frankreichs. Somit wurden alle Bewohner zu Franzosen erklärt, was der aus über 90 % bestehenden schwarzhäutigen Bevölkerung eine gewisse Wiedergutmachung beschert hat.
Denn ihre Vorfahren wurden aus allen möglichen Teilen Afrikas hierher gebracht und mussten auf den Zuckerrohr- und Bananenplantagen ihrer weißen Herren Fronarbeit verrichten. Im Zuge der Französischen Revolution 1789 schafften die Jakobiner die Sklaverei ab, Napoleon Bonaparte führte sie dann Anfang des 19. Jahrhunderts wieder ein. Seine 1. Gattin, Josephine de Taschner, erblickte in Fort de France, der heutigen Inselhauptstadt das Licht der Welt und beeinflusste ihn in dieser Angelegenheit; es steht in der Stadt sogar eine Statue von ihr, allerdings ohne Kopf, denn die Inselbevölkerung hegt verständlicherweise keine Sympathie zu ihr.
Erst 1848 im Rahmen der Bürgerrevolution wurde den Sklaven endgültig die Freiheit gegeben. Heute sind ihre Nachfahren stolze, selbstbewusste Menschen, die dem Fremden mit unaufdringlicher Freundlichkeit begegnen.
Unweigerlich zieht man Vergleiche mit dem tropischen Schwarzafrika, was man den afrikanisch stämmigen Leuten aber nicht unbedingt sagen muss. Denn auf meine Aussage meiner schwarzen Zimmervermieterin gegenüber, dass hier vieles wie in Afrika ist, muss ich zur Kenntnis nehmen: Non, non Afrique est pauvre, nous sommes des Francais! (Nein, nein Afrika ist arm, wir sind Franzosen!)
Und tatsächlich, bei genauer Betrachtung erkennt man den Unterschied zu Afrika schnell. Die Straßen sind von exzellenter Beschaffenheit, die Häuser sind sauber, illegale Müllablagerungen findet man in Deutschland häufiger, und das eigentliche Grundproblem, die Geburtenexplosion der 3. Welt ist längst Vergangenheit. Die Leute hier haben nicht mehr Kinder als in Festlandfrankreich und somit eine Perspektive für Wohlstand, was sich unter anderem an der Dichte des Autoverkehrs bemerkbar macht.
Die Preise für Lebensmittel sind in den Supermärkten nicht niedriger als in Frankreich, also ein guter Teil teurer als bei uns. Eine Ananas kostete für mich unerklärlicherweise 1 € mehr als bei uns in Deutschland, obwohl sie hier geerntet wird. Dafür ist dann Becker´s Bier von der Karlsberg Brauerei in Homburg/Saar ein gutes Stück billiger zu haben als das einheimische Bier mit dem Markennamen Lorraine. (Nach Aussage des Vermieters und Patrioten ist Lorraine das beste Bier der Welt!!) Obwohl die Küstenfischerei mit Sicherheit ertragreich ist, fiel mir im Kühlregal von HYPER-U, einem großen Supermarkt, Pazifikwildlachs mit Beschriftung in Deutscher Sprache auf… Anscheinend spielen die Frachtkosten bei der Preiskalkulation, wenn überhaupt, nur eine marginale Rolle.
Die Insel umfasst 1.128 qkm und ist somit halb so groß wie das Saarland, mit einer Einwohnerzahl von ca. 440.000 ist sie ungefähr gleich dicht besiedelt. Hauptstadt ist Fort de France mit ca. 160.000 Bewohnern. Wenn man vom Flughafen kommt, gewinnt man zuerst den Eindruck, in einer der Megastädte Kaliforniens zu sein, denn das hier bestehende Autobahnnetz drängt einen zu diesem Vergleich.
Die Landwirtschaft und die Weiterverarbeitung der daraus resultierenden Produkte bilden die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Die Erzeugung von Bananen steht an vorderster Stelle, gefolgt von Zuckerrohr, der den Grundstoff für den weltbekannten Martinique-Rum liefert. Weiterhin umfasst die Produktpalette Früchte wie Mangos, Avocados, Ananas, Kochbananen, Süßkartoffeln und eine Fülle mir unbekannter tropischer Früchte. Der Export von Schnittblumen boomt, und auch die Küstenfischerei ist nicht unbedeutend. Hin und wieder sieht man im hohen Gras auch Rinder, und Ziegen sind im Bereich der Dörfer allgegenwärtig.
Einen weiteren hohen Stellenwert bei der Schaffung des Bruttosozialproduktes hat natürlich der Tourismus, denn dem Besucher offenbaren sich hier die Traumstrände der Welt. Viele kommen hierher, um zu tauchen und zu segeln. Die Berge mit ihren tropischen Urwäldern in den großflächigen Naturschutzgebieten locken sicherlich auch einige wenige robuste Typen zum Wandern hierher.
Der Raid Manikou
So ca. 2 Stunden vor dem Start um 4.00 Uhr in der Früh treffe ich im Ort Deux Rivieres am äußersten Nordteil der Insel ein. Im Zentrum des ca. 2.000 Einwohner zählenden Dorfes neben der Kirche ist mitten über die Straße ein großes Transparent mit der Beschriftung DEPART gespannt. Mit Flutlichtern ist der Platz grell beleuchtet und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Weihnachtskrippenaltar von Maria, Josef und dem Säugling Jesus sind die Tische der Rennorganisation Raid Manikou aufgestellt worden.
Mindestens eine Halbhundertschaft von Teilnehmern ist schon anwesend. Viele davon sind Einheimische, aber auch etliche Abenteurergesichter von Europa sind dabei. Und gleich werde ich von einem jungen Mann mit dem Finisher-Hemd Raid du
Gouadeloupe gefragt, ob ich derjenige Deutsche bin, der mit ihm in 2006 auf Reunion zusammen ins Ziel gekommen war, was mich natürlich sehr freut. Ja, die Welt der Abenteuerläufe ist überschaubar…
Nach und nach vergrößert sich die Anzahl der Teilnehmer, von denen ca. 160 Leute zum Grand Raid Manikou mit 127 km antreten werden und ca. 50 Leute sind für den sogenannten Jungle Raid gemeldet, der 55 km Zurücklegen auf der selben Strecke bedeutet.
Wie immer wird die Stimmung der Partizipanten von großartigem Optimismus getragen. Meinem 100 MC-Kamerad Lothar Preißler, mit dem ich schon einige Hard-Trails unter anderen auf Reunion zusammen gemacht hatte, kann ich zur Begrüßung die Hand schütteln. Wenig später komme ich mit Gert Schilling, der ebenfalls die Diagonale der Verrückten bestanden hatte und seiner Freundin in Kontakt. Damit sind alle deutschen Teilnehmer zusammen. Gerts Freundin ist als einzige deutsche Teilnehmerin des Jungle Raids angetreten.
Noch ein Gesicht eines sehr großen jungen Mannes mit einer Wiener-Sänger-Knaben-Frisur fällt mir auf. Ich habe dieses auf Bildern von Bernie Conradts diesjährigem Reunion-Bericht gesehen. Es ist Jack Liver aus der Schweiz.
Im Gegensatz zu der Gepäckkontrolle auf Reunion macht man hier nur Stichproben, von mir will man nur die Taschenlampe sehen.
Reichlich ist der Tisch mit Baguettes, Schinken, Salami, Käse, Früchte etc., Tee und Kaffee gedeckt. Ich entscheide mich für 3 Salami-Sandwiches, mein Standardfrühstück bei Hardcore-Läufen, denn der Salzgehalt der Wurst erzielt eine positive Wirkung auf die erwartete spätere körperliche Wasserverdunstung. In meinem Rucksack trage ich unter anderem eine 2 l Trinkblase gefüllt mit Mineralwasser und trage in meiner Hand noch zuzüglich eine 1,5l Wasserflasche. Die Rennorganisation warnt ständig eindringlich vor den Gefahren der Dehydrierung durch Hitze und Überanstrengung…
Die meisten Akteure tragen wie beim UTMB Walkingstöcke mit sich, was hier im Gegensatz zum Grand Raid de la Reunion erlaubt ist. Klar, die bestockten Läufer sind mir Stocklosem im Vorteil. Ich denke aber, dass es auch ohne gehen muss…
Und wie üblich ist ein französischer Schnellredner wieder am Mikrofon und erteilt Ratschläge und Anweisungen. Leider verstehe ich nichts….
Die 6. Stunde beginnt und ein Pistolenschuss verkündet den Beginn der „Großen Reise“. Ganz hinten habe ich mich eingereiht, und dadurch bedingt, dass die Straße stark abfällig ist, kann ich erkennen, dass die Ersten losrennen, als stünde ihnen ein 100 m-Lauf bevor. Es ist ein immer wiederkehrendes Deja-vue-Erlebnis…
Da ich weiß, dass es nach wenigen 100 Metern hinter dem Ort gleich steil nach oben zum Vulkan Mont Pelee geht und ich nicht in einen zeitaufreibenden Läuferrückstau geraten will, renne ich auch. Noch keine 3 Minuten sind seit dem Start vergangen und ich schwitze schon wie in einer 100 Grad-Sauna…
Welch ein Glück, gleich hinter dem Ortsausgang beginnt schon der Höhenweg zum Vulkan als Treppe, man kann nicht mehr laufen. Mit federnden Schritten geht es die feuchten Treppenstufen nach oben, die dann in einen Pfad übergehen. Mit moderater Geschwindigkeit marschiere ich integriert in die Läuferschlange nach oben, immer auf der Hut sein müssend, nicht von vor mir schreitenden bestockten Teilnehmern, die mit ihren Stecken wie mit mittelalterlichen Spießen in der Luft herumfuchteln, verletzt zu werden.
Das Walkingstockverbot beim Grand Raid de la Reunion hat schon seine Bedeutung. Aber hier startet weniger als ein Zehntel der Teilnehmerschar als auf Reunion. Die Läuferschlange wird sich also schnell gelichtet haben…
Anders als in unseren geographischen Breiten ist der Tag mit einer nur sehr kurzen Dämmerung angebrochen. Es ist wolkig, wie fast immer unmittelbar am Mont Pelee. Es fällt ein wenig Nieselregen, was der Haut gut tut und die Hitze abmildert.
Überall auf dem Weg sind Ziegen anzutreffen. Manche laufen sogar frei herum.
Große tropische Gehölze umsäumen den Weg, der momentan sogar mit Traktoren befahren werden kann und moderat nach oben führt. An kleinen Bananenplantagen geht es vorbei. Ich sehe Wiesen mit 3 m hohem Gras, mit Rindern, die in Ihrem Futter unterzugehen scheinen, weil es ihnen über den Kopf wächst… und weiter geht es in den Urwald mit Lianen, Palmen, Farnen und tropischen Urwaldriesen. Auf dem Weg sind bedingt durch den vielen Regen überall Tümpel, die ich erfolgreich umlaufe.
Ein weißer französischer Läufer in meiner Altersklasse mit der Startnummer des großen Raids hat mich anscheinend als Konkurrenten auserkoren und bemüht sich immer vor mir zu bleiben. Mach nur…, wenn Du es brauchst, ich habe keine Probleme damit, denke ich mir.
An Lichtungen kann ich immer wieder die Erhabenheit der Naturlandschaft im Urzustand einige km weiter unter uns bewundern. Die verschiedenen Grüntöne der Flora begeistern mich und beflügeln meine Phantasie. Jetzt erspähe ich den ersten Großschmetterling, der ungefähr dreimal so groß wie unser einheimischer Schwalbenschwanz ist, und von der Farbe rot dominiert wird. Unwillkürlich muss ich an den Film “Papillon“ denken, ein Meisterwerk der 70-iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, der sehr eindrucksvoll von Steve McQueen als Hauptdarsteller in Franz. Guyana gespielt wurde, der Wald unterscheidet sich von den Wäldern dort, wenn überhaupt nur sehr wenig.
Ah, an einer Kurve ist ein Tisch aufgebaut, an dem ein Helfer der Rennorganisation Trinkwasser ausschenkt. Ich schütte gleich mehrere Gläser in meinen Rachen und fülle meine Flasche wieder auf. Die ersten 6 Kilometer sind jetzt zurückgelegt.
Wenige 100 m später wird der Weg immer steiler und verengt sich zu einem Pfad. Auch die Bäume werden jetzt niedriger. Hinter einer Kurve überholt mich wieder der Altersklassekonkurrent, Atemgeräusche von sich gebend, die an Dampflokomotiven erinnern. Gerne lasse ich ihn ziehen und bin der Überzeugung, dass er mit dieser Vorgehensweise nicht weit kommen wird… Alter schützt vor Torheit nicht, wie sich doch dieser alte Spruch immer wieder bewahrheitet, denke ich.
Kurze Zeit später sind an Stelle der Bäume Büsche getreten und der Pfad wird noch steiler. Anders als in den Alpen verläuft er nicht zickzackartig, um den Steigungswinkel abzumildern, sondern er führt frontal dem Berg entgegen. Ich überhole weitere Läufer, meistens mit den Startnummern des Jungle Raids, die mit pfeifendem Atem und hochroten Gesichtern für ihre Befindlichkeiten viel zu schnell unterwegs sind.
Plötzlich sind wir in den Wolken, die Sicht beträgt höchstens 40 m und es wird noch steiler. Von einem Pfad kann keine Rede mehr sein, wir bewegen uns nun auf nassem Gras die Höhe hinauf. Alle 20 m sind jetzt Banderolen an Stäben angebracht, ohne die eine Orientierung unmöglich wäre. In den dichten Wolken kann ich erkennen, dass ich mich auf einem nur wenige m breitem Grad befinde und es links und rechts steilst nach unten geht.
Immer wieder sind jetzt Klettereinlagen zu bestehen und ich sehe einen Naturholzstock vor mir liegen, den ein entnervter Konkurrent zurückgelassen hat, weil er ihm wahrscheinlich beim Klettern hinderlich war.
Ich freue mich darüber, im Moment behindert er mich natürlich auch beim Klettern, aber mir ist klar, dass der Bergabstieg genau so steil vonstatten gehen wird, und dann wird mir dieser Stock eine großartige Hilfe sein. Vom Streckenprofil weiß ich, dass diese infernalische Steigungsstrecke höchstens 4 km beträgt.
Vor mir taucht jetzt in der Wolkensuppe eine eindrucksvolle Gestalt auf, der ich mich rasch nähere. Es ist ein junger Mann von etwa 30 Jahren in etwa meiner Körpergröße, mit einer typischen Iron-Man-Figur ausgestattet und von der Natur mit einem sehr schönen Gesicht gesegnet. Irgendwann vor mehreren Generationen war sicherlich auch schwarzafrikanisches Blut an seiner Entwicklung beteiligt. Bei den Großleinwandfilmen der frühen 60-er Jahre, die die Zeit der Römer verkörperten, hätte er sicherlich große Chancen gehabt, eine Hauptrolle als Centurio oder als Gladiator zu bekommen.
Ich überhole ihn und wenige Minuten später ist er von den Wolken verschluckt.
Schließlich kommt eine Stelle in Sicht, wo es höhenmäßig nicht mehr weiter geht, zwei Leute von der Organisation stehen da. Der eine schenkt Wasser aus, der andere hakt meine Startnummer auf seiner Liste ab, mich mit dem überall auf französischem Boden gebräuchlichen „Bon courage“ begrüßend.
Puh, jetzt auf flachverlaufendem Pfad an der Caldera entlang, auf nassem Gras und von Gestrüpp umgeben, mich langsam joggend vorwärtsbewegend, spüre ich doch die Anstrengung in meinen Waden und Oberschenkeln. Ohne Wolken hätte ich jetzt eine phantastische Sicht auf den Rest der Insel; aber die Tage ohne Wolken sind beim Mont Pelee sehr selten.
Zu erwähnen ist, dass dieser Berg einer der gefährlichsten Vulkane der Welt darstellt. Am 8. Mai 1902 erlangte er eine traurige Berühmtheit, denn er brachte innerhalb weniger Minuten über 30.000 Menschen den Tod. Mit der Energie von über 50 Hiroshima-Atombomben brachte er die Apokalypse. Die Lava war nicht das Problem, Es war die Gaswolke, die bei der Eruption 250 Grad heiß und 500 Stundenkilometer schnell auf Saint Pierre, die ehemalige Hauptstadt der Insel, zuraste. Nur 2 Bewohner überlebten das Inferno. Das Haus des einen stand hinter einem Bergvorsprung im Windschatten, der andere saß zur Ausnüchterung im Kellerkerker der Polizeistation. (Es handelt sich dabei um einen der wenigen Fälle, bei denen Alkoholismus zur Lebensverlängerung beiträgt!?!)
Über 20 Jahre war die Gegend im Radius von 30 km um den Vulkan wüst und leer. Heute sind von Geologen seismologische Messinstrumente rund um den schlafenden Killerberg angebracht, die etwaige gefährliche Eruptionen im Vorfeld melden.
Ca. 2 km dauert der ziemlich flach verlaufende Parcours um die Caldera und ich erhole mich gut. Wie erahnt, so wie es steil nach oben ging, so geht es jetzt steil nach unten. Äußerst vorsichtig und relativ langsam steige ich ab, wie immer bei solchen Situation darauf achtend, Fußumknicken und Stürze zu vermeiden, denn spitze Felsen sind allüberall.
Von mehreren Läufern werde ich jetzt wieder überholt, auch von dem Gladiatorentypen, den ich später noch näher kennen lernen sollte.
Hin und wieder kommen uns Wanderer entgegen, die uns bestaunen und uns Nettigkeiten zurufen. Ja, das tut gut!
Nach einer gefühlten Ewigkeit ist nun am Fuße des Vulkans die erste große Verpflegungsstelle erreicht, an der ich eine Hand voll Rosinen zu mir nehme und mir mehrere Becher Cola genehmige. Hurra, die größte Hürde des Rennens ist geschafft, denke ich…
Ich betrachte die Gegend, die jetzt unterhalb der Wolken liegt und sehe in einer Entfernung von ca. 25 bis 30 km mehrere knallgrüne hohe Bergkegel am Horizont.
Aha, da kommt also die nächste Herausforderung , mein Optimismus ist ungebrochen. Laut Wegebeschreibung soll es bis dahin auf ordentlichen Landwirtschaftswegen oder Straßen weitergehen, was in der Realität auch zutrifft.
Immer gut durch Banderolen ist unser Weg gekennzeichnet, was das Verlaufen erschwert. Außerdem kann ich auf den feuchten Naturwegen auch immer Spuren von voranlaufenden Konkurrenten entdecken.
An intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, wo Zuckerrohr, Bananen, Orangen, Mangos, Süßkartoffeln etc. angebaut werden, verläuft die Rennstrecke immer wieder stark nach oben und nach unten. Etliche Dörfer werden durchlaufen, in denen die Bewohner zurückhaltend freundlich mir zuwinken. Das Wetter meint es gut mit uns, fast immer ist der Himmel bewölkt, nur selten kommt die Sonne durch. Sind aber Wolkenlöcher vorhanden, wird es sekundenschnell brüllend heiß, der Schweiß rinnt in Strömen und kann nicht verdunsten, weil es die Luftfeuchtigkeit nicht zulässt. Sonnenbrand habe ich diesmal nicht zu befürchten, denn ich habe vorgesorgt, indem ich mir Sonnenschutzcreme mit dem Lichtschutzfaktor 60 so dick auf die textilfreie Haut aufgetragen habe, dass ich aussehe wie ein Pantomime.
Ich komme gut voran, liege gut in der Zeit, habe viele Läufer noch hinter mir und fühle mich mal wieder supertoll. Ja, wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, dass ich einmal imstande sein würde, solche Ausdauerleistungen zu vollbringen. Nun laufe ich auf einem der schönsten Plätze der Welt, bin mittlerweile 63 Jahre alt (jung), atme die aromareiche Tropenluft wie früher Zigaretten ein, spüre die Fitness meiner Spätjugend in mir und schwebe sinnbildlich auf einer Wolke des Glücks.
Mittlerweile bin ich wieder an einer Großverpflegungsstelle angekommen, und zwar an der, die unmittelbar vor einem dieser besagten mit Urwald bewachsenen Bergkegel liegt. Ich lasse mich auf einem Stuhl nieder, verspeise Salamistücke mit Rosinen, trinke wieder viel Cola und lege die Beine hoch. Ach, ich habe ja so viel Zeit… und lasse es mir gut gehen. Gert Schilling mit seiner Freundin trifft ein, ich wollte gerade ein Gespräch mit ihnen beginnen, aber nach Wasseraufnahme und Einnahme eines kleinen Snacks enteilen sie sofort wieder.
Alle Leute, die ich überholt hatte und wahrscheinlich von Beginn an noch hinter mir waren, sind zwischenzeitlich eingetroffen. Der Altersklassekamerad, der am Vulkan dampflokomotivenhaft geschnauft hatte ist nicht mehr dabei. Ich denke, er hat aufgegeben.
Nach einer für mich schönen Ruhepause mache ich mich wieder auf den Weg. Es ist kurze Zeit danach, Stein zu Stein springend ein Fluss zu überqueren. Schon auf dem ersten Fels rutsche ich ab und stürze ins Wasser, das mir bis zum Rucksack reicht. Ich empfinde es als nicht schlimm, bringt es mir doch etwas Abkühlung. Jetzt denke ich das erste Mal daran, dass ich es versäumt hatte, Ersatzstrümpfe mitzunehmen. Für kurze Zeit plagen mich dumpfe Vorahnungen…
Bald erreiche ich eine Schautafel mit einer Wegeskizze. Darauf ist ein Pfad abgebildet, auf dem sich weiß gekleidete photographierende Touristen tollpatschig und stürzend vorwärts bewegen. Darüber steht ganz groß geschrieben: Trasse des Jesuites.
Sehr schnell begreife ich, dass diese humoristisch anmutende Zeichnung gar nicht so lustig ist, sondern die harte Realität widerspiegelt. Ich befinde mich auf einem Pfad in einem tropischen Bilderbuchurwald, der genau so gut im Amazonasgebiet wie auch am Kongo sein könnte. Zurzeit geht es immer wieder steilst nach oben… die Beschaffenheit des Pfades ist schmierseifenhaft glatt… mittlerweile sind die Wolken über uns verschwunden, die Sonne sonnt und brennt an wenigen Plätzen, an denen Urwaldriesen den Gewalten von Zyklonen zum Opfer gefallen waren.
Unendlich viel Kraft ist jetzt notwendig, um vorwärts zu kommen, und mein Stock leistet mir dabei wertvolle Hilfe. Ab und an verläuft der Pfad für kurze Strecken nach unten und ich rutsche dann die schwierigen Stellen mit dem Hintern hinab. Der Schweiß läuft in Strömen, obwohl es unter dem Schutz des Blätterdaches so schrecklich heiß doch gar nicht ist. Es ist wohl die fast 100 %ige Luftfeuchtigkeit, die meinem Organismus zu schaffen macht und den Schweiß nicht verdunsten lässt.
Beruhigt stelle ich fest, dass ich keine Kreislaufprobleme habe, nur muskuläre Ermüdungserscheinungen machen sich erstmals bemerkbar. Ab und zu überhole ich Läufer, die langsamer als ich vorankommen oder gerade eine Pause machen.
An einem kurzen steilen Abstieg stürze ich das erste Mal, wobei mein Stock zerbricht. Noch viele Male stürze ich, immer auf meinen Hintern fallend auf weiche rotbraune Lateriterde.
Ich werde immer langsamer. Da ich weiß, dass in etwa 2 Stunden der Cut-off kommt, und ich nicht weiß, wie weit es bis dahin noch ist, mache ich mir jetzt Sorgen und bedauere sehr, bei dem letzten Verpflegungspunkt so lange pausiert zu haben.
Die unvergleichliche Schönheit und Artenvielfalt des Regenwaldes kann ich intensiv in mich aufnehmen, gleichzeitig lenkt sie mich von weiteren negativen Gedanken ab. Sollte ich einige Minuten die Cut-off-Zeit überschreiten, so kann ich sicherlich mit den Leuten reden, beruhige ich mich selbst.
Aber immer steiler wird es, schnurstracks führt der Pfad den Berg hoch und die Uhr tickt. Die Zeitsorgen lassen sich nicht mehr verdrängen…. Wenige Minuten später sehe ich ca. 50 m über mir eine gelbgekleidete Gestalt. Es ist Lothar Preißler aus Berlin. Er steht auf einer Teerstraße und in einer Kurve ist eine Verpflegungsstelle aufgebaut, die gleichzeitig die berüchtigte Cut-off-Stelle darstellt. Bis zum Rennrauswurf habe ich noch über eine Stunde Zeit.
Lothar wurde es auf dem Jesuiten-Rutsch-Pfad kurz vor der Verpflegungsstelle schwarz vor den Augen, sein Kreislauf streikte. Er tat, was jeder vernunftorientierte Läufer tun würde. Er steigt aus und wartet jetzt auf einen Wagen, der ihn nach St. Anne zum Ziel bringt.
Ich verweile nur kurz, esse wieder Rosinen, schütte mehrere Becher Coca-Cola in mich hinein, lasse zur Aufheiterung der Rennhelfer einige Sprüche lauthals los und mache mich wieder auf den Weg. Jenseits der Straße sind wieder die wegweisenden Banderolen angebracht und sofort müssen so wieder 10 bis 15 m kletternder Weise überwunden werden. Noch steiler als bisher geht es weiter, ich denke, dass das jetzt das Maximum an Steigung darstellt. Mit Laufen hat die gegenwärtige Fortbewegungsart jedenfalls noch nicht einmal im Entferntesten etwas zu tun.
Aber auch immer wieder geht es bergab und es ist immer noch schmierseifenartig glatt. Es gibt zum Unterschied zu Reunion hier keine Eisenleitern und immer wieder stürze ich bei diesen Bergabpassagen verletzungsfrei. So langsam gewöhne ich mich an das fast kontrollierte Stürzen, vielleicht sind meine Adrenalinreserven aufgebraucht, befinde aber, dass mich dieses Procedere viel, viel Kraft kostet.
Angst vor Schlangen und ähnlichen unfreundlichen Kreaturen war bisher nicht aufgekommen. Aber gerade sehe ich unmittelbar vor mir 2 faustgroße Skorpione über den Pfad rennen… Der Anblick dieser Giftviecher erfreut mich keineswegs, aber dass sie die Flucht vor mir ergreifen, beruhigt mich. Mir wird jetzt klar, warum die Cut-off-Zeit um 16.00 Uhr eingeführt wurde. Die Existenz dieser Tiere und das Gefahrenpotenzial dieses Jesuitenhorrorweges, was Stürze angeht, können bei Nacht lebensgefährlich werden.
Noch ca. 10 km führt mich meine selbst gewollte Abenteuerreise auf dem Pfad weiter und nach vielen weiteren Stürzen erreiche ich schließlich mit stark erdgefärbter Kleidung einen Betonweg, auf dem ein PKW steht, dessen Fahrer mich mit Trinkwasser versorgt. Der Urwald ist hier zu Ende, ich befinde mich wieder auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet. Diese Mal ist es eine Weidelandschaft für Kühe.
An einer Kurve entledige ich mich fester Stoffwechselendprodukte und zwei Läufer eilen auf mich zu. Der eine hat eine Startnummer umgebunden, der andere nicht, und der entfernt die Banderolen an der Wegstrecke.
Au weia, außer dem einen Läufer haben also alle anderen hinter mir aufgegeben, stelle ich fest. Sie laufen an mir vorbei.
Ganz Letzter will ich doch nicht sein, ich erhöhe jetzt meine Jogginggeschwindigkeit und lasse sie wieder hinter mir. Ca. 2 km laufe ich auf dem Betonweg relativ schnell und habe sie wieder abgehängt. Hinter einem Bauernhaus führt die Wegestrecke wieder vom festen Weg weg, es beginnt ein felsiger Pfad, der durch Dschungel steil bergab geht.
Die kurze Dämmerungsphase hat bereits eingesetzt; ich bewege mich auf diesem gefährlichen Pfad mit äußerster Vorsicht weiter, die der Konkurrent nicht walten lässt, denn er überholt mich. Nun habe ich den Besenläufer im Nacken. Ich beginne ein Gespräch in meinem holprigen Französisch mit ihm, er stellt sich als gebürtiger Elsässer aus Straßburg vor, der nach Martinique ausgewandert ist und in Fort de France arbeitet. Leider spricht er überhaupt kein Deutsch, obwohl er Muller heißt.
Wenige Minuten später erreichen wir die Großverpflegungsstelle von km 55, die gleichzeitig das Ziel für die Jungle Raid Partizipanten darstellt. Es ist auch eine Cut-off-Stelle, die jedoch keine Gefahr für mich darstellt. Sofort nach Betreten der Station wird mir ohne mein Wollen eine Armmanschette umgelegt, eine junge Frau misst mir den Blutdruck, später auch den Puls. Meine Werte sind in Ordnung und sie wünscht mir einen weiteren guten Verlauf des Rennens.
Viele Tische stehen unter einem großen hölzernen Pavillon, an denen viele Raider das erste warme Essen zu sich nehmen. Ich setze mich an einen Tisch, an dem ein ungefähr gleichaltriger Kamerad mit seiner Begleiterin, die hier auf ihn gewartet hat, sein Abendessen einnimmt. Ich grüße mit einer lautstarkem „Mahlzeit!“ „Mahlzeit!“ schallt es gleich laut zurück.
Klasse, der Typ kann ja Deutsch sprechen und wir führen ein angenehmes Gespräch.
Ich erfahre von ihm, dass er ebenfalls in den letzten Jahren Abenteuerläufe wie den MdS, Grand Raid de La Reunion, UTMB unternommen hatte und auf den Vornamen Georges hört. Der Aufstieg zum Pelee sei für ihn sehr anstrengend gewesen und auch der Schreckenspfad der Jesuiten war für ihn die bisher härteste Strecke bei all seinen gefinishten Hard-Trails.
Wir unterhalten uns noch über die bevorstehenden Cut-off-Stellen und sind beide der Meinung, dass uns zeitlich kein Malheur mehr passieren kann. Auch soll es ja nach 85 km laut des im road-book abgedruckten Höhendiagramms bis auf eine Ausnahme niederländisch flach weitergehen…Und so beschließe ich, mich noch mindestens eine halbe Stunde an dieser komfortablen Verpflegungsstelle bei St. Joseph aufzuhalten.
Georges , der schon eine halbe Stunde früher als ich da war, will aufbrechen und im gemütlichen Tempo weitermachen. Sicherlich werden wir uns bald wieder begegnen, meint er zum Abschied.
Ich lege jetzt die Füße hoch, ziehe Schuhe und Strümpfe aus und begutachte erstmals meine Füße. Die Haut an den Zehen ist durch die ständige Nässe runzelig und schneeweiß geworden. Ich trockne jetzt die Füße mit meiner Fleece-Jacke ab und ruhe 30 Minuten barfüßig. Schmerzen an den Zehen habe ich noch keine; der äußerliche Zustand der Zehenhaut erfüllt mich doch mit Sorge, zumal noch über 70 km zu überwinden sind und ich von der künftigen Wegebeschaffenheit nichts weiß.
Nach dieser halbstündigen Siesta zwänge ich wieder meine schön abgetrockneten Füße in die klammen Socken und Schuhe und setze den Raid fort. Die Reise geht weiter über einen Betonweg, der durch Bananenplantagen führt. Mittlerweile ist es dunkle Nacht geworden. Das Nachtleben der tropischen Fauna ist erwacht und die nachtaktiven Lebewesen sind kommunikativ: Frösche quaken, Grillen zirpen und viele mir bisher unbekannt gebliebene Tierlaute kann ich vernehmen. Zig Fledermäuse, die mindestens doppelt so groß wie unsere einheimischen Arten sind, umkreisen mich und fliegen oftmals nur wenige cm an meinem Gesicht vorbei. Nach kurzer Zeit schon habe ich mich daran gewöhnt, und das Ganze bereitet mir kein Unbehagen mehr.
Der Himmel ist von Wolken verhangen, aber es regnet nicht, und die Temperatur ist angenehm, so ca. 22 – 25 Grad und für mein gegenwärtiges Wohlbefinden genau richtig. Da ich weiß, dass kein zweiter Vulkan zu besteigen ist und auch keine Schmierseifenpassage mehr kommen soll, bin ich mit mir und der Welt sehr zufrieden und hoffe, den Raid völlig problemlos hinter mich zu bringen. Leider sollte ich mich mal wieder gewaltig irren…
Mit meiner Taschenlampe verschaffe ich mir eine gute Sicht; der Weg ist flach und völlig unkompliziert zu laufen. Wenige Minuten später vernehme ich das Rauschen eines Flusses, und im Schein meiner Taschenlampe kann ich eine Flussfurt erkennen, die über die Betonstraße führt. Das Wasser fließt mit einer maximalen Höhe von 30 cm über die Straße, und die Furt ist so gegen 10 bis 20 m breit.
Und wieder muss ich ein unfreiwilliges Fußbad über mich ergehen lassen. Noch 7 Mal auf einer Distanz von vielleicht 2 km absolviere ich solche Nassquerungen. Einige Läufer habe ich mittlerweile eingeholt und kann erkennen, dass sie in Badelatschen unterwegs sind. Nach Beendigung der Furtpassagen ziehen sie sich wieder ihre trockenen Strümpfe und Laufschuhe an, und ich werde immer nachdenklicher…
Nach wenigen km ist eine stark mit PKW befahrene Autostraße zu traversieren und auf einem breiten Platz hole ich Georges ein. Der Raidverlauf führt nun ständig auf Beton- oder Teerstraßen durch Ortschaften oder an Ortschaften vorbei, denn die Gegend ist hier sehr dicht besiedelt und von den Höhen erblickt man ein riesiges Lichtermeer, le Lamentin, der internationale Flughafen der Insel ist nicht weit.
Besondere Ansprüche an die Trittsicherheit werden hier keine gestellt, denn es sind alles gut ausgebaute Autostraßen, allerdings ständig mit extrem großen Steigungswinkeln…Und beim Bergabjoggen spüre ich immer mehr meine Füße. Zuerst fühle ich das Wachsen von Blasen, um dann durch brennenden Schmerz das Platzen derselben zu erleben.
Schade, mit trocknen Socken und Schuhen wäre es nicht dazu gekommen. Dieses Ungemach wäre mir durch Mitführen von Badesandalen erspart geblieben. Georges hat ein zweites Paar Schuhe mit Socken dabei… und ich beneide ihn. Eine innere Stimme tadelt mich, indem sie mir zu Recht vorwirft, mich für diesen speziellen Event nicht genügend ausrüstungsmäßig vorbereitet zu haben.
Immer wieder kommen Ravitaillementstellen, die glücklicherweise Cola anbieten, denn mittlerweile laufen wir in der Nacht und ohne dieses Koffeingetränk würde sich die Müdigkeit stärker entwickeln. Der am Vulkan beschriebene Iron-man-Typ hat sich zu uns gesellt. Er heißt Pierre und wohnt in Schoelcher, einem Vorort der Hauptstadt.
Über Stunden laufen wir nun größere Wegestrecken im Flachen, fast nur durch Bananenplantagen, und die Gegend wirkt sehr, sehr eintönig. Wir können froh sein, nachts hier unterwegs zu sein, denn jetzt ist die Temperatur angenehm. Sicherlich sieht es tagsüber bei Sonnenschein ganz anders aus.
Roboterhaft stapfen wir kommunikationslos durch diese langweilige Landschaft. Die Füße brennen und automatisch versucht der Körper durch Veränderung des Laufstils den Schmerzen zu entkommen. Vergeblich. Durch das Betätigen von bisher nicht zum Fortbewegen benutzten Muskeln, Sehnen und Bändern entsteht eine weitere Pein.
Ich führe zwar Aspirin mit mir, traue mich aber nicht, die Tabletten einzunehmen, weil ich nicht weiß, ob ich gänzlich gut hydriert durch das Rennen kommen werde, denn die Einnahme von Analgetika bei Dehydrierung kann zu bleibenden Nierenschäden führen.
Von Joggen, auch bergab, kann nun schon seit geraumer Zeit keine Rede mehr sein. Pierre und Georges bewegen sich jetzt mit ihren Walkingstöcken auf den Wegen voran wie reife Frauen in der Menopause bei uns in Deutschland. Und ich stampfe in einer Körperhaltung weiter, als hätte ich einige Liter Bier zu verdauen.
Es ist hell geworden und an einer Verpflegungsstelle mitten in einem Dorf so gegen 7.00 Uhr machen wir mal wieder eine kleine Sitzpause, indem wir uns für wenige Minuten auf Stühlen niederlassen.
Wie immer, wenn der Morgen erwacht ist, weicht die Müdigkeit neuer Zuversicht. Wenn nur diese schlimmen Fußschmerzen nicht wären und auch unterhalb des Rumpfes schmerzt mir nun alles. Bei George glaube ich einen über Nacht zustande gekommenen Oberkörperneigungswinkel nach links festgestellt zu haben.
Am Ortsausgang biegt der Raidparcours von der Straße links auf einen Kreuzweg ab. Das muss der weltweit steilste Kreuzweg sein, denn er ist so steil, dass wir ca. alle 10 m zum Entspannen stehen bleiben müssen. Die Steigung erscheint mir stärker als die am Vulkan zu sein. Etwas Gutes hat das Ganze: Die zum Überwinden dieses Horrorberges erforderliche körperliche Kraftanstrengung lässt die Schmerzen an den Füßen und Beinen in den Hintergrund treten.
Nach einer endlos gefühlten Zeit ist die Bergspitze erreicht und genau so brutal geht es wieder auf Stein- und Wurzelpfaden bergab. Die Schmerzen sind zurückgekehrt, und zwar stärker als je zuvor.
Pierre ist hinter uns geblieben und außer Sichtweite geraten. Wir kommen wieder in Bananenplantagen, ständig geht es saftige Anhöhen hoch und runter. Laut Höhendiagramm ist die Gegend hier holländisch flach. Der Himmel ist gegenwärtig fast wolkenlos, die Temperatur hat sicherlich die 30 Grad überschritten und die Luftfeuchte beträgt 100 %. Rückenschmerzen machen jetzt meinen Fuß- und Beinpeinigungen Konkurrenz. Durch den permanenten Schweiß auf meiner Haut hat der Rucksack mittlerweile meinen Rücken wundgescheuert. Von nun an kann ich meinen Rucksack nicht mehr auf dem Rücken tragen, sondern ich schleppe ihn mit mir wie ein Gewehr auf der linken oder rechten Schulter. Nach wenigen km ist Pierre wieder aufgerückt.
So gegen 9.00 Uhr erreichen wir den Verpflegungsplatz km 86, wo laut Wegbeschreibung die Rennrauswurfzeit auf 13.00 Uhr festgesetzt ist. Hier duschen viele Raider und machen Schlafpausen auf in einer Halle und außerhalb davon platzierten Feldbetten. Es fällt mir auf, dass ca. ein Dutzend Teilnehmer hier das Rennen abbrechen, indem sie in einen Kleinbus einsteigen. Auch ein Arzt ist anwesend, der gerade Wundbehandlungen und Massagetätigkeiten bei Konkurrenten vornimmt.
Ich melde weiteren Handlungsbedarf an meiner Person an und nach einer längeren gefühlten Zeit des Wartens bin ich an der Reihe. Als ich den Zustand meiner Zehen und Fersen sehe, wird mir fast schlecht und kann mir vorstellen, dass Leprakranke solche Füße haben. Mit teilnahmsloser Mimik desinfiziert er die Wunden mit einer roten Flüssigkeit sowohl an den Füßen als auch am Rücken. Abpflastern kann ich mir die Zehen dann selbst, dafür hat er keine Lust. Mit einem Neidgefühl beobachte ich Georges, wie er gerade Schuhe und Strümpfe wechselt. Seine Füße befinden sich in einem eindeutig besseren Zustand.
Egal, nach ca. 1 Stunde Pause brechen wir wieder auf. Die Pause hat gut getan und nur noch ein knapper Marathon ist zu machen. Mit großspurigen Sprüchen wie „ein Marathon ist in Wirklichkeit doch nur ein Kurzstreckenlauf“ sprechen wir uns selbst Mut zu…
Als Georges sich mit seinen Stöcken so vor mir herschleppt, fällt mir auf, dass sein Oberkörper sich wieder ein gutes Stück nach links unten hin verändert hat. Unwillkürlich fällt mir der Vergleich zum Schiefen Turm von Pisa ein. Pierre beugt seinen Oberkörper immer weiter vor.
Das Wetter ist jetzt so ganz anders als gestern. Die Sonne brennt, es ist heiß, der Wind ist kaum spürbar, obwohl in der Ferne Rotoren von Windkraftwerken in Bewegung sind. Der Badwater-Ultramarathon kommt mir in den Sinn, nur dass die Kühlung bringenden Supporter fehlen.
Meine Fußschmerzen sind wieder genau so schlimm wie vor der ärztlichen Behandlung. Sehr mühsam und schwerfällig schleppe ich mich momentan mehrere 100 m hinter den beiden Kameraden vorwärts. Na ja, es ist ja nicht das erste Mal im Leben, dass ich mich bei einem Ultralauf ganz unten fühle. Nur glaube ich, noch nie solche Schmerzen gehabt zu haben.
Schließlich ist Macabou erreicht, 95 km sind geschafft und von nun an werden es die letzten 33 km fast nur noch am Meer entlang gehen, wo ich mir etwas Abkühlung durch den Wind verspreche.
Nach einer viertelstündigen Pause mit Suppe und viel Cola gehen wir zum Strand. Es gibt weiße Sandstrände hier, mehrere km weit mit Kokospalmen umsäumt. Die wenigen Badegäste verlieren sich auf der mehreren km langen Fläche. Die Meeresbrandung ist gewaltig und kalifornische Surffanatiker fänden hier sicherlich ihr Mekka. Jedoch vom kühlenden Wind bemerke ich nichts.
Ich laufe jetzt unmittelbar am Wasser, denn dort ist der Sand fest und gut zu gehen. Leider erwischt mich trotz Zurückspringen immer wieder mal eine Welle und nässt meine Füße. Auch sammelt sich immer mehr Sand in den Schuhen an…
Ja, es ist jetzt wie beim Marathon des Sables, und die sandigen nassen Strümpfe üben einen Schmirgelpapiereffekt auf meine sowieso schon brennenden Füße aus.
Schade, wir laufen auf den schönsten Sandstränden dieses Planeten und können es überhaupt nicht genießen. Die schlimmen Schmerzen versauen alles. Völlig kommunikationslos und apathisch stapfen wir nebeneinander oder hintereinander her.
Reiß Dich zusammen, ruft mir der innere Guthund zu, es sind weniger als 25 km, das ist doch keine Entfernung…
Es gibt hin und wieder Verpflegungsstände mit kleinen Snacks und Getränken an verschiedenen Strandabschnitten, immer unter schattenspendenden Büschen oder Bäumen angelegt. Die Rennhelfer sind sehr freundlich und hilfsbereit. Doch ich muss feststellen, dass die Zahl der angegebenen km in der gefühlten Wahrnehmung um ein Vielfaches größer ist.
Auch die beiden Kameraden sind der gleichen Ansicht. In unregelmäßigen Abständen werden die Sandstrände von Felsenküste unterbrochen. Das bedeutet wieder Bergsteigen und Klettern. Seit Stunden habe ich mittlerweile das Gefühl, als steche mir eine Nadel ständig in den großen rechten Zeh und tue es als Einbildung ab.
An einer Pausenstelle ziehe ich den Schuh aus… und tatsächlich steckt ein Dorn einer Tropenpflanze so ca. 1,5 cm tief in meinem Schuh. Ah, eine permanente und fürchterliche Schmerzquelle kann ich nun beseitigen.
Vielleicht ist mittlerweile ein gewisser Schmerzgewöhnungseffekt eingetreten, jedenfalls ich habe wieder Augen für die Schönheiten der Gegend. Ich erspähe vorgelagerte Inseln mit dichtem Urwald bewachsen. Teile des Ufers sind jetzt mit dichten Mangrovenwäldern bewachsen, die tief ins Meer hineinreichen. Und mittlerweile geht unser Marsch durch eine von Menschenhand unberührte Savannenlandschaft mit mannshohem Gras, um dann schließlich in eine Sanddünenlandschaft zu gelangen. Es sieht hier aus wie in der Sahara und unwillkürlich drängt sich der Vergleich zum Marathon des Sables auf.
Pierre, der auch den MdS schon gefinisht hat, lässt verlauten, dass der Lauf in der Sahara im Vergleich zum Raid Manikou ein Kinderspaziergang ist. Georges und ich sind absolut gleicher Meinung.
Wir befinden uns jetzt kurz vor km 120 und es wird fast ohne Dämmerung wieder dunkel. Es geht jetzt also in die zweite Nacht, und die ersten Sinnestrugbilder narren mich in Form von Hexen- und Teufelsfratzen an Büschen und Bäumen. Ich weiß, dass dagegen nur Schlafpausen, seien sie auch nur sehr kurz, helfen.
Wir erreichen einen größeren Verpflegungsplatz direkt am Sandstrand, an dem ein großes Lagerfeuer brennt. Daneben ist eine Plastikplane auf dem Boden ausgebreitet, auf dem einige Läufer ruhen. Ich trinke einige Becher heiße Suppe und viel Cola und kann trotzdem nur mit größter Mühe meine Augenlider am Zufallen hindern. Pierre sitzt auf einem Stuhl neben mir und schläft mit eingeschalteter Stirnlampe.
Georges steht auf seinen Walkingstöcken weit mit dem Oberkörper vorgebeugt und mir scheint, dass seine Oberkörperlinkslastigkeit weiter vorangeschritten ist. Ich denke mir, dass es Zeit wird, ins Ziel zu gelangen, denn bald wird er der Schwerkraft Tribut zahlen müssen, nach links fallen und dann liegen bleiben. Jetzt ganz intensiv meine Müdigkeit spürend und Angst habend bei etwaigen weiteren Kletterpassagen abzustürzen, entschließe ich mich für eine Stunde Schlafpause auf der Nylonplane. Ich fordere Georges auf, es mir gleich zu tun. Anfangs sträubt er sich noch dagegen, nachdem ich ihn aber auf seine Oberkörperlinksentwicklung hinweise, hat er Einsehen. Mit großem Ächzen und Stöhnen und äußerst mühevoll gelingt es ihm schließlich, sich hinzulegen. Einen Rennhelfer bitte ich, uns eine Stunde später zu wecken.
Bevor mir die Augen zufallen, sehe ich noch, wie man den auf dem Stuhl eingeschlafenen Pierre die Stirnlampe ausschaltet. Ich träume gerade, auf einem fliegenden Teppich zu liegen und vom Wind durchgeschüttelt zu werden, als ich wieder in das reale Diesseits eintrete. Ich werde vom Rennhelfer wachgerüttelt, die Schlafstunde ist zu Ende. Georges steht schon wieder auf den Beinen, gestützt auf seine Gehhilfen und Pierre wird gerade gerüttelt.
Es ist wie schon öfters gewesen; tatsächlich die Stunde Schlaf hat die Müdigkeit besiegt. …Es sind nur noch 7 km und frohgemut wird die Fußreise fortgesetzt. Nach ca. 1 km überholen wir noch 1 Läuferpaar. Die Frau schleppt sich an 2 Holzstöcken, die sie wie Krücken benutzt, äußerst schwerfällig weiter. Pah, ihr gegenüber geht es mir ja noch goldig… Pierre hat nun eine schnellere Gangart eingelegt, und wir verlieren ihn aus den Augen.
Im Moment ist es leicht und locker auf relativ festem Sanduntergrund zu gehen und auch die wunden Füße senden nicht mehr so große Schmerzsignale. Die Wegestrecke ist jetzt wirklich holländisch flach, laut Karte sind weniger als 6 km noch zurückzulegen, hurra, sehr bald wird erneut ein schwerer Raid gefinisht sein…
Doch immer öfter bleibt Georges stehen, um den Oberkörper nach vorne zu beugen und mit seinen Stöcken abzustützen, und mir scheint, dass die Linksverdrallung noch weiter zugenommen hat.
Auf teils festem, teils lockerem Sand schleppen wir uns weiter voran, an einem Platz vorbeikommend, wo wenige Meter rechts von uns die Meeresbrandung rauscht und wenige Meter links neben uns ein Dschungel beginnt mit großen steil abfallenden Teichen mit lautstarkem Fröschengequake. Sicherlich wimmelt es auch in den Weihern von Alligatoren und ich bemühe mich, immer einen guten Sicherheitsabstand zu den Stehgewässern einzuhalten.
Nach einer endlos gefühlten Zeit erreichen wir schließlich die Kontrollstelle km 124. Wieder machen wir Stuhlsitzpausen und trinken viel Coca-Cola, die Müdigkeit kehrt wieder ein. Aber es sind ja nur noch 3 km….
Auf zum letzten Gefecht… weiter… hinter einer Kurve geht es wieder auf Wurzel- und Felsenpfaden sehr steil hinauf und wieder hinab. Die Füße brennen, ich habe den Eindruck, die Beine wollen sich vom Restkörper lösen. Georges bleibt jetzt alle 200 Meter stehen, den Oberkörper nach vorne auf seinen Stöcken abgestützt , leise vor sich hin röchelnd.
Ein Mann von der Rennorganisation taucht in der Dunkelheit hinter uns auf und begleitet uns jetzt. Anscheinend machen wir beide einen solch jämmerlichen äußeren Eindruck, dass die Rennorganisation das Schlimmste befürchtet und wir beaufsichtigt werden müssen.
Schwer, sehr schwer fällt mir jetzt alles. Mein innerer Schweinehund rät mir, solchen Unsinn bloß nicht wieder zu machen. Auch 100 km-Läufe seien absolut idiotisch und sogar normale Marathons seien körper- und hirnschädigend.
Und wieder führt die Raidbanderole vom Weg ab zum jetzt sehr unebenen Sandstrand, an dem mir gerade wieder eine Welle die feuerbrennenden Füße nässt. Gefühlsmäßig löscht aber kein Wasser den Brand, eher kommt es mir so vor, als würde Kerosin zum Feuer gebracht…
Aber jetzt endlich führen mit gelber Farbe aufgemalte Wegepfeile auf einem Betonweg in den Zielort St. Anne. Es ist mittlerweile nach 2.00 Uhr im frühen Morgen, uns begegnet nur ein betrunkenes Nachtschwärmerpärchen, das keine Notiz von uns nimmt. Noch ca. 1,5 km geht es auf der Straße entlang dem Campingplatz entgegen, wo sich das Ziel unter dem Triumphbogen Arrivee befindet.
Trotz blutwundem Rücken schnalle ich mir jetzt wieder den Rucksack über und mit hochgerissenen Armen laufe ich zusammen mit Georges Hand in Hand so aufrecht wie irgendwie möglich durchs Ziel…
Es ist vollbracht und wieder durchbeben mich intensivste Glücksgefühle. die tagelang anhalten und im weiteren Leben unvergessen bleiben werden…!
Nachwort
Der Raid Manikou wäre für mich sicherlich leichter und schöner zu bewerkstelligen gewesen, hätte ich folgende Ausrüstungsgegenstände mit mir geführt: Badesandalen, ein 2. Paar Laufschuhe und mehrere Ersatzstrümpfe sowie Walkingstäbe - und hätte ich mir meinen Rücken im Vorfeld abgetapert.
Die Flugkosten der Air France betrugen € 635 für 2 Wege. Es ist ein stark reduzierter Spezialtarif, der über die Organisation vom Raid Manikou für die Teilnehmer angeboten wurde. Ebenfalls durch die Vermittlung von Patrick Chapelle, dem Organisationsleiter des Raids, fanden wir eine wunderbare Unterkunft im Norden der Insel bei dem Ort Precheur in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vulkan und nur wenige 100 m vom Strand entfernt in paradiesischer Tropenlandschaft.
Die Zimmer sind groß, angenehm eingerichtet, sauber und sehr preisgünstig = 35 € für 2 Personen die Nacht incl, Frühstück. Die Vermieter; Manuel & Sandra, sind sehr liebenswürdige Leute, die uns zu sich an Weihnachten eingeladen hatten.
Wer sich ernsthaft für eine Teilnahme an diesem großartigen Rennen interessiert, kann mich unter meiner Tel. Nr. 06507/4158 kontaktieren. Gerne werde ich die individuellen Fragen beantworten.





 Special Event
Special Event


 zur�ck zur �bersicht
zur�ck zur �bersicht